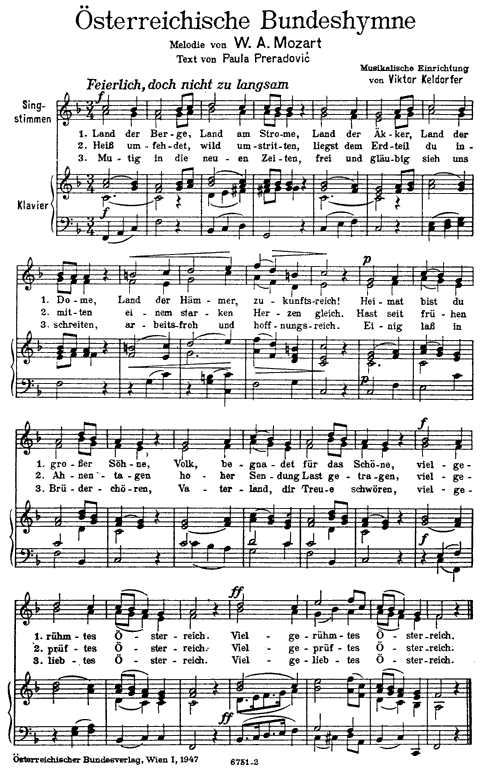... befinden sich in meiner Bibliothek: eine Taschenausgabe des »Zarathustra« von Nietzsche — und ein schmales Bändchen: »Auf den Marmorklippen«. Diese beiden Bücher begleiteten meinen Vater im Tornister durch seine Kriegsjahre an der Ostfront. Über den Zarathustra wird vielleicht bei Gelegenheit (z.B. am 25. August heuer, wenn ein »Halbrunder« ansteht, sonst eben in fünf Jahren, sub conditione Jacobæa) zu lesen sein — heute geht's um das andere Buch eines fürwahr »zeitlosen« Autors ...
Fast einhundertdrei Jahre sind es bei ihm geworden, und heute — lebte er noch — wäre er eben einhundertzwanzig Jahre alt. Ob der Bundesgauckler und die alternativlose frühere FDJ-Sekretärin aus diesem Anlaß auch kämen, ihn zu ehren? Vermutlich ja, denn die sind ja überall, wo sie Blitzlichtgewitter wittern. Weil wir schon beim Wittern sind — eine feingestimmte Nase hatte er zweifellos! Für Vergangenes ebenso wie für Künftiges.
Irgendwie steht er wie ein erratischer Block aus fremdem Gestein in der mittlerweile von Mollusken aller Sorten bewohnten Literatur-Schwemmlandschaft Deutschlands. Irgendwie ... ... französisch mutet er an mit seinem Stil, und seiner bisweilen preziösen Sprache. Dennoch: 999 von 1000 heutigen »Autoren«, die ihn selbstmurmelnd öffentlich verdammen, würden sich alle Finger abschlecken, wenn sie bloß einmal im Leben ein paar Sätze so gekonnt lapidar und einfühlsam hinschreiben könnten ... ... wie es sie auf fast jeder Seite von »Gärten und Straßen« gleich mehrere gibt.
Der Kenner der Literatur und dieses Blogs hat es längst erraten: die Rede ist von Ernst Jünger. Den — für die biographischen Detailinformationen — sonst obligaten Link auf die (deutsche) Wikipedia erspare ich mir (und meinen Lesern), denn abgesehen von »harten« biographischen Fakten, ist deren Artikel geradezu exemplarisch bloß eines: ideologischer Schrott (man vergleiche selbst den sicherlich nicht unvoreingenommenen Artikel auf
Wikipédia damit, und man geniert sich für die deutsche Version ...)
Ernst Jüngers Lebenswerk (d.h.: 22 großformatige Bände inkl. der Supplemente) wirklich zu würdigen, ist auf einem Blog weder Zeit noch Platz — das erforderte wenigstens fünfzig Seiten (oder mehr). Deshalb nur einige wenige Andeutungen, was — zu dem obigen familiär-biographischen Grund — diesen Autor für mich so faszinierend macht.
Jünger ist der Prototyp eines »essayistischen« Autors (sein Erzählwerk ist bloß getarnte Essayistik!), und das ist in der deutschen Literatur so selten, wie in der französischen häufig. Er verbindet freilich französische Essay-Eleganz mit deutscher Gründlichkeit zu einem ebenso ungewöhnlichen, wie sprachlich faszinierenden Ganzen.
Freilich muß ich zugeben: meine Annäherung an Ernst Jünger erfolgte zunächst von der — wenigstens für mich — »falschen« Seite, nämlich über die Erzählwerke, nämlich über die »Marmorklippen« und »Heliopolis«. Denn wenn ich auch von der kühlen, stilisierten Sprache beeindruckt war, so war mir doch alles viel zu sehr »hinter Glas« gemalt, als daß ich mich dafür wirklich hätte begeistern können.
Erst die Lektüre von »
Gärten und Straßen« änderte das mit einem Schlag. Aufgelesen in einem Antiquariat, mit etwas Neugier durchblättert, las ich mich daran bald fest, insbesondere, weil jene Landschaft Nordfrankreichs, die Jünger darin bescheibt, von mir einige Jahre vorher selbst bereist worden war, und Jüngers Gedanken und Eindrücke einen faszinierenden Kontrapunkt zu meinen Erinnerungen spielten.
Endgültig gewonnen hatte er mich allerdings mit seinen »
Annäherungen«, obwohl doch diese Analyse von Drogen im Selbstversuch mir als notorisch »unberauschten« Menschen (es sei denn, man zählte eine gelegentliche Zigarre oder das Glas Wein zum Mittagessen schon zum Suchtverhalten) eigentlich fern liegen müßte. Dennoch (oder vielleicht: gerade deshalb) war die Lektüre, welche Rauschzustände durch welche der geschilderten Drogen und mit welchen Manifestationen eintreten, für mich so faszinierend.
Und so begann meine Reise durch Jüngers Tagebücher, angefangen bei den »
Strahlungen« (deren erster Teil, »Gärten und Straßen«, bereits erwähnt wurde), bis hin zum vielbändigen Spätwerk »Siebzig verweht«.
Ernst Jüngers Stil kann leicht parodiert werden — die lakonische Apodiktik der Sätze eignet sich hervorragend dazu. Nur ist das ein Beweise für die Minderwertigkeit des Stils? Auch Rilke, Benn oder Hofmannsthal wurden (teilweise höchst gelungen) parodiert ...
Bis heute gilt Ernst Jünger als »umstritten«. Das wäre auch durchaus begrüßenswert, denn wer zu früh zum »Klassiker« stilisiert wird, pflegt dementsprechend bald ein »Archiv-Klassiker« zu werden, den man zwar in Lexika und Germanistikprüfungslisten mitschleppt, aber kaum freiwillig liest —
»Wer wird nicht einen Klopstock loben ...« — nur ist »umstritten« ja in Wahrheit das Codewort für die faktische Zensur der Gutmenschen, die uns damit einen Wink mit dem Zaunpfahl gibt, was zulässigerweise in den Diskurs eingebracht werden darf, und was nicht. Und wer in diesen Kreisen Jünger zitiert, läuft schnell Gefahr, per Kontakt-Kontamination zum Unberührbaren abzusinken.
Jünger selbst hat das nicht mehr betroffen: sein durch Leserinteresse (auch aus dem Ausland, v.a. aus Frankreich) erfolgreiches literarisches Schaffen überstand den Versuch untergriffiger Schmähung und gezielten Totschweigens. Und irgendwann war Jünger einfach so unvorstellbar alt geworden, und seine unermüdlichen Gegner einfach weggestorben, daß sich jede Fehde erledigte. Die Nachkommen nahmen den erratischen Block in der Literaturlandschaft als naturgegeben hin, zumal auch Jünger kaum von den Debatten und Zwistigkeiten des Literaturbetriebs Notiz nahm. Da klassifizierte er lieber Insekten oder Gräser — und wer die Eitelkeiten unserer Gegenwartsliteraten und ihrer Kritiker kennt, kann ihm nur rechtgeben ...


_by_J%C3%B3zef_Brandt.PNG/1024px-Battle_of_Vienna_(1683)_by_J%C3%B3zef_Brandt.PNG)