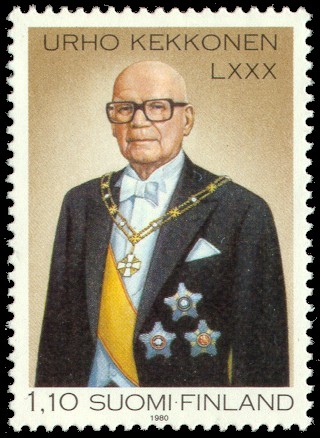Mittwoch, 3. September 2025
Heute vor 125 Jahren
Mittwoch, 20. August 2025
Heute vor 80 Jahren
Am 10. Mai 1932 gehörte er zu der Gruppe demokratischer Intellektueller, die Carl von Ossietzky bei Antritt seiner Haftstrafe in Berlin demonstrativ begleiteten. Nach Hitlers Machtergreifung in Deutschland 1933 emigrierte Roda Roda bereits im Februar zu seiner Schwester, der Ärztin Gisela Januszewska nach Graz, nachdem er durch eine Satire auf Hitler im Berliner Tagblatt aufgefallen war und Goebbels daraufhin im Angriff seine "Unschädlichmachung" gefordert hatte.
Das Bauerngehöft lag noch in tiefer Finsternis. Die Uhr im Zimmer schlug zwei nach Mitternacht. Um halb drei sollte die Kompagnie abmarschieren. Signale blies man nicht, man war ja in Feindesnähe. Der Korporal vom Dienst ging zuerst in den Viehstall, da war der zweite Zug einquartiert, und rief:
»Hörts, Burschen! Es is Tagwach.«
Er mußte nicht einmal sehr laut rufen. Die meisten waren ohnehin schon wach. Je müder der Mensch ist, desto weniger Schlaf hat er.
Die im Viehstall sammelten sich also aus dem Stroh, räkelten sich und wischten die Montur obenhin mit der Hand vom Stroh rein. – In diesem Viehstall und immer auf demselben Stroh hatte heute schon die achte Einquartierung geschlafen – jede Nacht eine andre – so wie sich die Truppen nordwärts konzentrierten. Das Stroh war klein gebrochen und mürb wie Kleie.
Der Korporal vom Tag weckte in der Scheune noch den ersten und den dritten Zug. Um den vierten brauchte er nicht zu sorgen, der kampierte im Garten und hatte sicherlich schon das Reißen in allen Gliedern von dem verdammten Nebel und Tau.
Dann kletterte der Korporal die Leiter hinan auf den Heuboden. Da schliefen die drei Herren Offiziere, dann der Herr Dienstführende, der Herr Manipulierende, der Herr Kadett-Korporal und – die Herren Offiziersdiener. Allerwärts schmuggeln sich ja die Diener in die Vorrechte ihrer Herren ein.
Eine kleine Viertelstunde später war schon alles parat. Aber der Nebel – der Nebel . . .
Der Herr Hauptmann nahm die Meldungen ab und kommandierte: – »Habt acht!« – so ernst, wie nie, seit sie die Garnison Essegg verlassen hatten. Da merkten alle, daß etwas ungewöhnliches vorgehe.
»Burschen,« sagte er, »heut führ ich die meisten von euch zum erschtenmal vorn Feind. Nehmts euch zusamm, machts es denen Kapitulanten nach, die was mit mir schon bei Magenta und Solferino gewesen sein. Zeigts denen Preisen, was ihr könnts. – Das gilt auch für Sie, Herr Leutnant.«
Darüber errötete der Herr Leutnant. Und ärgerte sich, daß man ihn, den neuausgemusterten Neustädter, mit den Rekruten in einem Atem genannt hatte. Der »altgediente« präterierte Kadett-Korporal biß sich auf die Lippen. Dann gings aus dem Gehöft auf die Straße. In diesem Augenblick hörte man weit – weit zwei Schüsse hallen.
Der Herr Hauptmann befragte einen vom Adjutantenkorps, der grade vorbeiritt, und kriegte zur Antwort:
»Ja – es geht los – – wahrscheinlich bei Chlum.«
Sie marschierten zwei Stunden und rasteten drei Stunden mit den Tornistern auf dem Rücken.
Die Sonne stand ziemlich hoch wie ein silberner Teller am Himmel, aber immer noch Nebel überall. – Wie unheimlich das war: Kanonengrollen auf allen Seiten, und keiner wußte, woher und wohin. Dragoner, Artilleristen, Likaner, Jäger, Husaren, Ulanen, Infanterie, Generale, Sachsen, Ordonnanzen, Adjutanten – alles sah man grau auftauchen, im Näherkommen Farbe gewinnen und wieder verschwinden.
Auf einmal hieß es:
»Habt acht! – Schultert! Marschieren – mir nach! – Kompagnie marsch!«
Drei geschlagene Stunden und in welchem Tempo! Um halb zwei nachmittag, die Landschaft hatte sich ein wenig aufgehellt – da kam ein Reiter und meldete irgend etwas. Der Herr Hauptmann sah sich um und rief:
»Korporal Enzinger mit zwei Mann! Suchen S' sich die Leut selber aus. Zwaa gschickte ältere Leut. Gehn S' da in das Buschwerk – segen S' dorten die zwaa kleinen Fichten? Dort gehn S' hinein in das Buschwerk, rekognoszieren S' es gut durch und kommen S' mir melden.«
Korporal Enzinger war ein syrmischer Schwab, aus Ruma gebürtig, und hatte zwei Landsleute in der Kompagnie. Die rief er sich – ein wenig familiär – heraus:
»Geh her do, hörst es, Pfirter – un du aa, Jakob.«
Dieser Jakob hieß mit dem Zunamen Pader.
Der Herr Hauptmann hätte dem Enzinger jetzt gern was erzählt über solch lässige Art, zu befehlen, überlegte sichs aber. »Lassen wirs für heut. Wer weiß, ob wir . . .«
Ehe noch der Gedanke gedacht war, dröhnten in nächster Nähe Kartätschenlagen. Jawohl, Kartätschenlagen – man erkannte es deutlich am Brausen. Und ein Gewehrfeuer, als würde ein Sack Erbsen auf Blech geschüttet.
Korporal Enzinger also ging mit den zwei Gemeinen los – zuerst ein wenig zaghaft, das Gewehr angriffsbereit – los auf die Fichten. Ihre Silhouette verschwamm wieder von Minute zu Minute.
»Paßts obacht, Burschen, paßts obacht – indem daß ma wenig siecht bein dem Nebel.«
Pader sagte:
»Herr Kapral, soll aaner von uns zerscht hinschießen in dö Schikara. Is richtig a Preiß dorten, nachher . . .«
»Is eh wahr,« erwiderte Enzinger. »Alsdann – An! Feuer! – schieß du!«
Pader schoß mit einigem Widerstreben. Sie knieten alle drei in einer Rainfurche und starrten erwartungsvoll nach dem Busch. Aber dort rührte sich nichts. Natürlich: der Nebel trog, die Fichten standen eine Stunde weit, aber vor der Sonne.
»Gehn mr.«
Und sie gingen weiter.
Als sie endlich bei den Fichten auf dem Bergkamm waren, da sahen die Spitzbuben erst, daß sie mit ihrem Patrouillengang das große Los gezogen hatten: da war keine Seele; man hatte sie offenbar vom äußersten Flügel weggeschickt.
»Alsdann jetzt zruck!« rief Enzinger, ging aber statt zurück, vor.
Die zwei andern merktens – er vielleicht auch. Sie sagten aber einer dem andern nichts in ihrer heimlichen Freude. Es war ein Komplott der Seelen, durch kein Wort, nicht einmal durch einen Blick eingestanden.
So gingen sie weiter – immer weiter. Keine Spur von Soldaten. Nicht Freund, noch Feind. Sie waren weit ab vom Schlachtfeld, der Kanonendonner dröhnte schrecklich hinter ihnen her. Als die Sonne zur Rüste ging, sah sie die drei Schwaben allein im tiefsten Waldesfrieden.
Der Korporal bekam Angst. Alle möglichen Kriegsartikel drohten ihm mit Pulver und Blei.
»Gemeiner Pader und Gemeiner Pfirter,« begann er plötzlich in dienstlichem Ton, »jetz ihr könnts mir bezeugen: indem daß a so a Nebel war, ham mir halt net zruckgfunden. No – is es so oder is es net so? – Jakob, sag auf dein ehrlichs Gewissen: jetz – kannst du dös ableugnen?«
Gemeiner Jakob Pader blieb stehen und sagte mit kristallner Überzeugung:
»Wann mi der Herr Hauptmann fragt: Wo seids ös gesteckt? Jetzt – lugen kann i net, Herr Kapral. Alsdann kann i nur dös melden: Herr Hauptmann, sag i, i meld ghursamst, mir ham rekomesziert, un wie mir zruck san – indem daß mr nindersch net die Kommanie gsegen ham – no ja . . . no – so san mir immer weider – immer weider . . . No ja, lugen kann i do net?«
»So is,« bestätigte Pfirter. »Mir ham rekomesziert.«
Der Korporal ließ die Gewehre zusammensetzen. Dann legten sie sich in eine Mulde und schliefen wie tot ein. Die Tornister waren ihre Kissen. Enzinger, Pfirter und Pader versäumten so die Schlacht bei Königgrätz mit all ihrem schrecklichen Blutvergießen – Enzinger, Pfirter und Pader verschliefen so den Rückzug über die Elbe.
Und es fielen in dieser Schlacht vier hundert fünfzig Offiziere und sieben tausend zwei hundert drei und achtzig Mann.
Pfirter erwachte am andern Morgen zuerst, denn er war der gefräßigste. Bald fuhren auch die andern auf, und nun saßen sie da und ratschlagten, was zu tun wäre. Daß vor allem menagiert werden sollte, war allen dreien klar. Aber was? – Kommißbrot. – Sie hatten sonst nichts. Pader meinte, ob man sich nicht etwas schießen könnte.
»Wie willst denn mit der Kugel?« wandte Pfirter ein.
»Ma könnt a Kugel mit 'n Baganet af Schrot zerhacken.«
Ehe sie Zeit hatten, darüber nachzudenken, erfaßte Enzinger mit jeder Faust einen von ihnen eisenfest am Ärmel und blickte starr in eine Lichtung. Halb verdeckt durch dünne Zweige tanzten dort hinten preußische Pickelhauben.
Die drei syrmischen Schwaben legten sich platt nieder, die Gewehre auf die Tornister und warteten, was es würde. – Totenblaß.
»Wie vieli saans?« lispelte Enzinger.
Keine Antwort.
»Wenigsens a Sticker zehni werns sein.«
»I sieg zwaa.« – Wenn Enzinger geseufzt hatte, Pader hauchte nur. – »Zwaa siegt ma. Aber fragen S' mi, wie vieli daß es saan – jetzt dös waaß i net.«
Die drei sahen in herzbeklemmender Spannung die Pickelhauben hinter dem Astwerk wackeln – da knackte und trampfte gerade vor ihnen ein schwerer Tritt durchs Reisig, und im nächsten Augenblick starrte . . .
Ja, im nächsten Augenblick starrte ein rotbärtiger, schmutziger, hungriger Preuße von drei Schritt weit auf drei Büchsenläufe – die hatten sich unwillkürlich halb und schwankend auf ihn erhoben. Er gurgelte etwas, erbleichte und – stand.
Pader faßte sich zuerst und schlug an.
»Pardon,« stammelte der Preuße mit blutleeren Lippen.
Er tats nicht etwa, um sich gefangen zu geben. Er sagte Pardon, weil . . . weil . . . nun, weil . . . mein Gott, was sollte er sagen? Er ist ein gut erzogener Mensch, Papierfritze von Profession – und da wollen ihn drei in einem böhmischen Wald erschießen. Wenn ein Meteorstein neben ihm niedersauste – Fritze hätte sicherlich auch Pardon gesagt.
Pader ist ganz Held.
»Alsdann Sö ergöben S' Ihnen?« fragt er Papierfritzen – leise aber fest. Enzinger sieht, daß er jetzt auf dem Punkt steht, seine Autorität zu halten oder zu verlieren.
»Ergeben S' Ihnen oder net?« fragt er und richtet die Spitze des glitzernden Bajonetts gegen Fritzens Brust.
»Pardon.«
»Alsdann knien S' nieder!«
Fritze – er heißt wirklich Fritze und ist aus Pankow – Fritze kniet. Jeder Papierhändler an seiner Stelle täte dasselbe. Die drei Schwaben sehen einer den andern an. Denn keiner weiß, was tun.
»Gefangener – wie vieli seids ös?« fragt Pfirter – um doch auch teil am Ruhm der Genossen zu haben.
»Wie, bitte, meenen Se?«
»Wie vieli daß ös seids, Gefangener!«
»So. – Es – seitz«, murmelt Fritze verständnislos und höflich. Höflichkeit ist die Seele des Papiergeschäftes.
»Wie vieli?« wiederholt Pader.
»'ch so – 'ch so – 'ch so – bitte sehr, wa sinn hier vier Mann, meene Herren, allens jebildete Familienväter – deutsche Familienväter.« – Papierfritze heult immer lauter.
»Fritze, Fritze,« tönt es von hinten, »wo treibst de dir man rum, Menschenskind? Bist de in wat jetreten?«
Die Pickelhauben nähern sich. Enzinger legt an und schießt. Trifft aber niemand. Bum – wrr . . . – schwirrt eine Kugel vom Zündnadelgewehr durch die Luft. Die drei Schwaben machen vorschriftsmäßig ihr Kompliment: die erste Kugel, die so nahe an Fritzen, an Enzinger und den andern vorbeikommt.
»Herr Jefreita! Herr Jefreita! – Hören Se doch. Ick bins. – Landwehrmann Friedrich Schmidt.«
Hier drei und dort drei stehen sich gegenüber, Fritze zwischen den beiden Parteien. Pader springt auf, nimmt Gewehr bei Fuß und sagt:
»Mir saan deitsche Leit.«
Jetzt ists an den Preußen, sich stumm zu beraten.
»Drei un drei,« sagt der Gefreite endlich – »Fritze zählt nich. Ick jloobe, meine Herren, wa tun uns nischt.«
Sie saßen zwei Stunden später in einem kleinen Hegerhaus und teilten vier preußische Erbswürste in sieben Teile. Die Hegerin hatte Milch, Brot und schwarze Pegatsche gebracht.
Sie erzählten einander ihre Erlebnisse, verglichen und betasteten ihre Armatursorten, sprachen von der Politik, vom Krieg, von Weib und Kind, die sie zu Hause hatten – lachten einander mancher Namen und Ausdrücke wegen aus – wunderten sich über die Verschiedenheit ihrer Dialekte – und auch darüber, daß sie alle Deutsche sind, so weit voneinander sie auch ihr Heim haben.
Sie gefielen einander und beschlossen, die Nacht über beisammen zu bleiben. Und sie blieben auch und schliefen seelenruhig unter einem gastlichen Dach – viel länger und bequemer als jemals seit ihrem Abmarsch vom Haus.
Am nächsten Morgen wollten sie aufbrechen. Aber wohin? Aus der Alten brachten sie nichts heraus. Sie konnte nur tschechisch.
»Co se mně pláte vohyn - vohyn - dyt' Vás nerozumím.«
Überdies – mit dem Fortmarschieren hatte es seinen Haken. Da draußen, jenseits des Waldes, hatte eine furchtbare Schlacht getobt, da standen Tausende und Tausende Soldaten beider Heere. Gingen sie aus dem Wald – konnten sie nicht gradenwegs in die Gefangenschaft rennen? Oder gar in den Tod? Wer weiß, was draußen vorging? Das Kanonenfeuer ruhte – aber für wie lang?
Pader hatte eine Idee: Sie sollten die Monturen tauschen. Sind dann die drei Österreicher als Preußen gekleidet und treten aus dem Wald – auf jeden Fall sind sie sicher: treffen sie auf Preußen, bleiben sie unbehelligt; man wird sie für Brüder halten. Treffen sie auf Österreicher – nun, so geben sie sich gefangen und zu erkennen. –Die Preußen in österreichischer Montur machens dann ähnlich. –
Was? Ein prächtiger Gedanke? Er blieb aber unausgeführt. Erstens, weil er den beiden Kommandanten zu gewagt schien – alles wäre herausgekommen, denn die Maskerade hätte doch erklärt werden müssen. – Zweitens, weil Papierfritze heftig widersprach – denn für ihn war kein weißer Waffenrock mehr vorhanden.
Sie berieten und erwogen – unterdessen wurde es Nacht, und sie blieben wiederum im Hegerhaus. Sie fanden ein Spiel Karten, aus denen pflegte die Hegerin wahrzusagen. Das gab eine unterhaltliche Partie Schwarzen Peter – zwei Pfennig für einen Kreuzer gerechnet. Österreich siegte.
Die sieben Deutschen saßen am dritten, saßen am vierten Tag immer noch da. Endlich, als die arme, einsame Alte nichts mehr zu essen für die Krieger hatte, marschierten sie fürbaß. Enzinger, der Älteste, führte. Die Hegerin wies ihnen den Weg. Am Waldessaum schüttelten sie einander kräftig die Hände – wie innige Freunde, die gemeinsam an ein waghalsiges Werk gehen.
Dann formulierten sie die Bedingungen ihres Separatfriedens:
Je nachdem, ob die erste Truppe, auf die sie stoßen, preußisch ist oder österreichisch, soll die eine oder die andre Patrouille die Gewehre wegwerfen und gefangen sein.
Die Hegerin ging ins Dorf als Spionin.
Korporal Enzinger Andreas,
Gemeiner Pader Jakob,
Gemeiner Pfirter Josef
und
Gefreiter Müller II.,
Landwehrmann Ostrowsky,
Landwehrmann Schmidt,
Landwehrmann Tiedemann
warteten am 8. Juli 1866 gespannt auf die Rückkunft ihrer Wirtin. Es handelte sich darum, wer am dritten die Schlacht bei Königgrätz gewonnen hatte: Preußen oder Österreich.
»Ob wa uns denn nu im Leben wiedasehn?« fragte Schmidt schwermütig.
»Ja, ja – da Kriech!« seufzte Tiedemann. »Da dämliche Kriech! – So jemütliche Leute, die Östreicher! Is nu nich schade, daß wa nich beisammbleiben könn?«
»Wahr is,« bestätigte Pader. Die beiden andern Schwaben nickten.
Da kam ein tschechischer Bauer des Wegs. Er führte einen Wagen mit zwei Kühen und erschrak gewaltig, als er die Soldaten im Busch erblickte. Bleich hing er an der Leitkette und glotzte um die Wette mit seinen Kühen. Korporal Enzinger hatte das zehnte Dienstjahr hinter sich und konnte sich, wie alle alten Soldaten, armeeslavisch verständigen. Er begann auch gleich ein Gespräch:
»He, guten Tag – dobar dan,« rief er kroatisch. Und setzte ruthenisch fort: »Kuta wy idschotsche – Wohin gehts?« – Polnisch – slovenisch – tschechisch – alles durcheinander, bis der Bauer endlich Laut gab und genug erzählte.
Und was tat der treulose schwäbische Schlaufuchs Enzinger?
»Brider,« sagte er, »indem, daß bei eich Preisen alles hin is – ös seids gschloga – so gengen mir zruck.«
Sprachs und marschierte mit seinen Leuten auf und davon.
Als die arme Hegerin spät am Abend heimkehrte, traute sie ihren Augen nicht: alle Zivilkleider ihres seligen Mannes hatten ihr die verdammten Soldaten gestohlen.
Vierzehn Tage später waren Enzinger, Pader und Pfirter nach mannigfachen Fahrten und Fährnissen glücklich bei ihrem Regiment. Sie erzählten, sie kämen aus preußischer Gefangenschaft und hätten sich selbst ranzioniert. Man fragte sie viel und staunte sie gehörig an.
Der Herr Oberst ließ sich sie zum Regimentsrapport vorführen und klopfte jedem besonders auf die Schulter.
Samstag, 9. August 2025
Vor fünfzig Jahren, am 9. August 1975
Schostakowitsch starb am 9. August 1975 an einem Herzinfarkt. Unter den vielen Kränzen, die das Grab schmückten, war auch einer des KGB.
Er wurde auf dem Nowodewitschi-Friedhof in Moskau bestattet.
Programme notes by Marianna Kankare-Loikkanen:
The year 1975 marked the 500th anniversary of one of the great artists of the Renaissance, Michelangelo Buonarroti. He was not only a brilliant sculptor but also a philosopher who viewed society around him with a critical eye and recorded his sentiments in the form of spontaneous poetry sketches in his diary and letters, sometimes even on his sketches. More than 300 such simple yet many-faceted “messages from the heart” survive.
Composer Dmitri Shostakovich was in poor health in autumn 1973: he spent more than two months in a Moscow hospital. Although his strength was failing, he still had energy for one final effort, writing a number of pieces that became his artistic last testament. Shostakovich had read poems by Michelangelo in a Russian translation by Abram Efros and appreciated their simple beauty and profundity of thought. Their topics – the calling of an artist and the meaning of art; truth and justice; death and immortality – struck a chord with him, and he employed them to create a self-portrait. For decades, he had had to keep silent. But now his time was up, and he knew it.
Shostakovich appears to have viewed the setting of Michelangelo’s texts fondly. He spent the middle of summer 1974 at his beloved Repino on the isthmus of Karelia. The song cycle to Michelangelo’s poems for bass and piano was completed on the last day of July. In December, Evgeny Nesterenko and pianist Evgeny Shenderovich premiered the work at Glinka Hall at the Leningrad Philharmonia in the composer’s presence. In early November, Shostakovich completed an orchestration of the songs, and in March 1975 – five months before the composer’s death – Nesterenko recorded them with the composer’s son Maxim Shostakovich conducting the Soviet Radio and Television Symphony Orchestra. Shostakovich still had sufficient strength to attend the recording.
Michelangelo did not give titles to his trifles, so the composer named them himself, having chosen eight sonnets and three poems, arranging them in an appropriate order. The texts comprise a stylistically remarkably coherent whole compared with Shostakovich’s satirical vocal works, which constitute another main group in his vocal music alongside settings of philosophical texts.
The composer underlines the poet’s voice with numerous quotes from his own compositions over the years. Immortality opens with a playful melody written at the age of nine, leading with a tinkle of bells to a new morning and eternal life. Night features a nod to the Nocturno movement of Shostakovich’s last String Quartet op. 144. The cycle builds up into a compelling monologue merging the voices of two giants, at times threatening and judgmental and at times gentle and melancholy.
The song cycle could be described as symphonic not only in style but also in dramaturgy. The poems can be grouped into four categories with different moods: the first ‘movement’ consists of the declaratory Truth and the lucidly lyrical Morning, Love and Separation; the second movement consists of the dramatic Wrath, Dante and To the Exile.
War die erste Atombombe noch ein verbrecherisches Experiment
Freitag, 8. August 2025
Heute vor 75 Jahren
---
---
---